Über den Kampf von Nullen und Einsen
Ich habe in „Themenboykott – Wenn der Kopf die Kündigung verlängert“ beschrieben, wie ein innerer Widerstand entsteht, wenn man eigentlich längst weiß, dass es vorbei ist.
Ich kündigte damals selbst zum 31.10.25. Das geschah nicht aus Faulheit und nicht aus Feigheit, sondern aus Erschöpfung und Verantwortung für mich selbst. Auch auf die Gefahr hin, eine Sperre zu kassieren. Das Arbeitsrecht hatte ich zwar auf meiner Seite, aber man weiß ja selten, über welche Hürden man tatsächlich gehen muss. Ich tat es auch in der Gewissheit, dass ich im neuen Jahr eine neue Arbeitsstelle antreten werde.
Was ich damals im Text nicht geschrieben habe – weil es unangenehm ist, weil es nicht heroisch klingt – ist der Gedanke, der sich in solchen Phasen fast zwangsläufig einschleicht:
Man könnte das auch einfach durch Krankschreibung überbrücken.
Zwei Monate.
Boreout, psychosomatische Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Magenprobleme, diffuse Schmerzen – alles keine Erfindungen, sondern reale Begleiterscheinungen eines Arbeitsverhältnisses, das mehr als verrottet war.
Ärztlich wäre das vermutlich problemlos zu begründen gewesen. Moralisch fühlte es sich für mich dennoch falsch an. Nicht, weil Krankheit simuliert worden wäre, sondern weil sie von mir instrumentalisiert worden wäre.
Ich habe mich daher dagegen entschieden.
Das tat ich nicht aus Stärke, sondern aus einem Rest an Selbstachtung. Und aus dem naiven Vertrauen heraus, dass ein System, in das man 45 Jahre lang eingezahlt hat, den berechtigten Übergang mit Entgiftung auffangen würde, wenn man ihn sauber, offen und ohne Tricks vollzieht.
Ehrlichkeit und Leistung sollen sich ja angeblich auszahlen.
Und außerdem, ich bin ja versichert. Sozial versichert …
Dieser Text handelt davon, wie sich dieses Vertrauen in staatliche Strukturen im Kontakt mit der Arbeitslosenversicherung verändert hat.
Arbeitslos werden – ein dreiteiliger Akt
Arbeitslos zu werden ist kein einzelner Moment, sondern ein dreiteiliger Akt, der sich weniger wie ein Vorgang anfühlt als wie ein schrittweiser Rollenwechsel.
Der erste Akt ist technisch und für das Jobcenter auch die formal wichtigste Aktion. Man meldet sich arbeitslos. Drei Monate vorher oder sofort nach Kenntnis, sonst droht Sperre. Ein Datum. Ein Klick. Eine formale Zäsur. Das geht erstaunlich leicht. Vielleicht, weil man innerlich noch glaubt, damit Ordnung zu schaffen.
In meinem Fall zeigte sich eine eigentümliche Absurdität: Je nachdem, ob die Meldung über PC und Internetbrowser oder über die Smartphone-App erfolgte, landete man bei unterschiedlichen Zuständigkeiten.
Am Rechner: nur eine größere Stadt am Rhein – hier musste ich einen Vermittlungstermin machen.
Über die App: nur eine kleinere Stadt am Rhein in meiner direkten Nähe – hier kam dann die Meldung über das digitale Postfach, dass ich einen Vermittlungstermin hätte.
Beides korrekt.
Beides offiziell.
Beides gleichzeitig zuständig?
Dass ich dem eService ausdrücklich zugestimmt hatte, änderte nichts daran, dass Papierpost verschickt wurde. Digital und analog parallel, ohne erkennbare Logik, aber mit dem Slogan, dass Jobsuche und Arbeitslosengeld jetzt so einfach wie Onlineshoppen wären. Es kam sogar noch einmal ein Schreiben mit dem Terminhinweis aus der kleineren Stadt.
Notwendige Vermittlung von eigentlich Nichts
Der zweite Akt ist sozial. Es folgte das Vermittlungsgespräch. Den Termin bekam ich inklusive Name der persönlichen Sachbearbeiter:in.
Das System, es lebt.
Zuerst durch die Schleuse der Security. Die prüfenden Blicke erinnerten mich irgendwie an Discobesuche.
Dauer der Vermittlung: etwa 10 Minuten.
Der Grund: Ein neuer Job war bereits gefunden und online gemeldet. Das Gespräch hatte exakt eine Funktion – die Abmeldung zum Starttermin vorzubereiten. Keine weitere Beratung, keine Vermittlung, keine Perspektive. Ein Gespräch, das stattfand, weil es vorgesehen ist, nicht weil es notwendig gewesen wäre.
Immerhin erfuhr ich, dass es eine vierwöchige Nachlaufversicherung meiner Krankenkasse gibt. Einen Monat also eine Sorge weniger, falls tatsächlich eine Sperre gekommen wäre. Diese Information bekam ich übrigens nicht automatisch von der Krankenkasse, sondern über Nachfragen, Recherche und ja: auch durch Unterstützung einer KI. Das war sozial wärmer als das System.
Von der Kasse erhielt ich lediglich ein informelles Schreiben darüber, was ich zu tun, zu befürchten oder zu unterlassen hätte. Kein Hinweis auf diese gesetzliche Absicherung.
Arbeitslosengeld beantragen war online noch nicht möglich, weil der Button dazu fehlte. Angeblich taucht dieser erst bei Fristbeginn auf. Anscheinend schont das System damit seine digitalen Ressourcen – um sie der Hotline aufzudrücken ..
Aber ok, bis hierhin fühlte sich alles noch steuerbar an. Formal, manchmal absurd, aber beherrschbar.
Der dritte Akt ist der härteste.
Für 60 Prozent Restwürde.
Der Antrag auf Arbeitslosengeld.
Hier kippt etwas.
Vertrauen gegen Existenz
Der zwölfseitige Onlineantrag mit rund einem halben Dutzend eigener Dokumente ließ sich zunächst nicht absenden. Nicht wegen fehlender Unterlagen oder offener Fragen, sondern wegen einer Kleinigkeit:
„Bitte hinterlegen Sie Ihre Bankdaten.“
Das System ließ das allerdings nicht zu.
Begründung: Das Vertrauensverhältnis reiche nicht aus. Um dieses höhere Vertrauensverhältnis herzustellen, müsse man sich über die BundID identifizieren. Dafür wiederum sei ein onlinefähiger Personalausweis notwendig. Den hatte ich dummerweise noch nicht.
Der Antrag war damit erstmal blockiert.
Dabei hatte ich mich längst arbeitslos gemeldet, ein persönliches Vermittlungsgespräch geführt, meine Identität bestätigt und sogar bereits einen neuen Job gemeldet. Aber meine eigene Bankverbindung durfte ich nicht eingeben, weil dem System noch nicht genug Vertrauen bestand.
Warum überhaupt Bankdaten für einen Erstantrag nötig sind, der noch entschieden werden muss, kann ich nicht beantworten. Vermutlich schlägt hier schlichte IT-Logik jede rationale Erwägung.
Die Existenzsicherung hing nun an einem Chip im Ausweis. Einem digitalen Personalausweis den Bürger:innen zwar nicht unbedingt für ihr alltägliches Leben benötigen, aber selbst bezahlen müssen, weil ihn der Staat gerne hätte.
Meine Sachbearbeiterin für Vermittlung war hier nicht zuständig. Sie könne aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht in meinen Account. Ich solle mich an die Leistungssachbearbeitung wenden.
Oha. Es gibt sogar zwei Postfächer für Kontaktaufnahmen:
– Vermittlungspostfach
– Leistungspostfach
Welch luxuriöse Ausstattung
Das eine weiß vom anderen nichts. Datenschutz durch Defragmentierung. Wie praktisch.
Der Umweg als Lösung
Die Bankdaten ließen sich schließlich doch hinterlegen. Über ein Schreiben in meinem Jobcenter-Leistungs-Postfach. Zweimal interveniert. Sogar mit unterschriebenem PDF.
Irgendwann waren die Daten im System. Ohne Mitteilung, ohne Bestätigung, ohne Hinweis. Man merkt es nur, wenn man aktiv überprüft. Man muss also mit dem Zufall rechnen.
Jobcenter Online – mit der Verlässlichkeit eines schlecht programmierten Systems
Die Bankdaten sind nun für mich sauber ausgeixt, damit ich ja keinen Unfug mit ihnen anstelle.
Funfact: Sie bleiben auch mit höherem Vertrauensverhältnis über BundID ausgeixt. Den neuen Personalausweis hatte ich zwischenzeitlich beantragt und erhalten.
Gibt es wirklich Betrüger:innen, die falsche Bankdaten eingeben, wenn sie Leistungen auf ihr eigenes Konto haben möchten? Offenbar wurde der Slogan mit dem Onlineshoppen etwas zu wörtlich genommen.
Digitalisierung als Sortierung
An dieser Stelle drängt sich ein grundsätzlicher Gedanke auf. In Deutschland versteht der Staat unter Digitalisierung offenbar weniger Vereinfachung als Sortierung.
Bürger:innen werden nicht entlastet, sondern in Nullen und Einsen eingeteilt.
Die Null ist im Digitalen kein Fehler, sondern der definierte Zustand der Inaktivität. Kein gesetztes Bit, kein aktives Signal.
Die Nullen sind daher jene, die sich selbst durch digitale Formulare, Pflicht-Rechtstexte und technische Hürden kämpfen müssen. Sie nutzen vielleicht KI, Hilfeseiten oder Zufallstreffer, um Systeme zu bedienen, die angeblich für sie gemacht sind, ihnen aber jede Menge Zeit, Nerven und Geduld abverlangen.
Die Einsen hingegen verfügen über Rechtsabteilungen. Sie lesen dieselben Texte nicht, um sie zu verstehen, sondern um sie zu umgehen. Sie identifizieren Fristen, Ausnahmen, Gestaltungsspielräume. Wo die einen klicken, interpretieren die anderen.
Beide Gruppen bewegen sich formal im selben digitalen System. Real jedoch unter völlig unterschiedlichen Bedingungen.
Digitalisierung wirkt hier nicht nivellierend, sondern verstärkend. Sie überträgt bestehende Machtverhältnisse in Software und nennt das Effizienz.
Was als „so einfach wie Onlineshoppen“ beworben wird, entpuppt sich im Alltag als Zugangshürde. Wer die technischen und juristischen Voraussetzungen nicht erfüllt, bleibt hängen – nicht aus mangelnder Mitwirkung, sondern weil das System genau so gebaut ist.
Die Erfahrung mit dem ALG-Antrag war kein technischer Ausrutscher. Sie war eine konsequente Folge dieses Verständnisses von Digitalisierung.
15 Arbeitstage – Die Zeitschleife
Zum Zeitpunkt der Antragstellung fehlten mir zwei vollständige Monatsgehälter. September und Oktober waren vom vorherigen Arbeitgeber nicht ausgezahlt. Der Umstand, dass Gehaltszahlungen aktuell und in der Vergangenheit erheblich verzögert und eventuell nur über Teilbeträge eintrafen, war im Antrag penibel dokumentiert und einer der Hauptgründe für meine Kündigung.
Der Antrag auf Arbeitslosengeld wurde am 5. November 2025 gestellt. Kurz darauf kam die Mitteilung, dass der ehemalige Arbeitgeber bis zum 19. November Gelegenheit habe, die Arbeitsbescheinigung online einzureichen. Dass bereits Lohnabrechnungen, Verträge und weitere Nachweise vorlagen, spielte keine Rolle. Die Bestätigung musste aus genau dieser Quelle kommen, oder man wartete.
Diese Verzögerung ließe sich theoretisch durch einen Antrag auf vorläufige Entscheidung mindern. Wahrscheinlich dauert aber auch die vorläufige Entscheidung über die endgültige Entscheidung ihre eigenen 15 Arbeitstage.
Am 20. November fragte ich nach, wann mit einem Bescheid zu rechnen sei. Die Antwort: Ich solle Geduld haben. Die Bearbeitungszeit betrage in der Regel 15 Arbeitstage.
Am 9. Dezember fragte ich erneut nach. Die Rückmeldung: Es fehle noch ein Dokument – eine von mir ausgesprochene frühere Abmahnung an den Arbeitgeber. Nicht, weil sie nie existiert hätte, sondern weil sie intern offenbar nicht mehr auffindbar war. Ich lud sie erneut über die App aus meiner gesendeten Postfachnachricht hoch. Das heißt: Da sie im meinem Postfach als versendet erschien und downloadbar war, ist sie im System.
Die Antwort:
„Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 15 Arbeitstage.“
„Bitte gedulden Sie sich.“
An dieser Stelle erinnerte ich mich an das HB-Männchen und vermied bewusst eine innere Eskalation meiner Synapsen und schickte sie alle rauchen.
Hotline
Wartezeit: etwa 30 Minuten.
Dann endlich eine Sachbearbeiterin, die sich meinen Fall anschaute. Sie fand das geforderte Dokument ebenfalls nicht, obwohl es mit dem Erstantrag über mein Jobcenter-Postfach hochgeladen worden war. Das System habe es nicht. Sie verstand wenigstens die Situation mit fehlenden Löhnen, ausbleibendem Arbeitslosengeld und setzte einen Dringlichkeitsvermerk.
Aha. Das geht also.
Warum dieser Vermerk nicht früher gesetzt wurde, blieb offen.
Insgesamt dauerte die Bearbeitung rund fünf Wochen.
Warten als Systemzustand
Für die Behörde ist Zeit ein neutraler Faktor. Für den Antragsteller ist sie existenziell.
Miete, Krankenversicherung und laufende Abbuchungen lassen sich nicht auf „in der Regel 15 Arbeitstage“ vertagen.
Während die Verwaltung prüft und mit ihrem eigenen System kämpft, trägt der Mensch das Risiko.
Der Betrag
Als der Bescheid am 11.12.2025 schließlich kam, war er korrekt. Rechnerisch sauber. Rechtlich natürlich nicht angreifbar.
(Ein Update folgt, sobald der Betrag überwiesen ist. Hoffentlich stimmen die Bankdaten….edit: Am 16.12.25 erfolgte Geldeingang)
Ein beschämend niedriger Betrag.
Kein Fehler. Kein Missverständnis. Nur das Ergebnis einer fremdgestalteten Lebensformel.
Dieser Betrag ist keine Absicherung. Er ist eine Überbrückung unter Vorbehalt. Er reicht vielleicht irgendwie, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, die Miete niedrig ist, Rücklagen existieren und der Zeitraum kurz bleibt.
Er zwingt mich, darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn ich keine Rücklagen hätte. Oder keine familiäre Sicherheit. Oder alleinerziehend wäre.
Nicht moralisch, sondern rein rational betrachtet ist das Geschwätz mancher Politiker:innen und Volksökonom:innen über überbordenden Sozialstaat und Mindestlöhne nicht nur erbärmlich, sondern zutiefst abstoßend.
Es sind noch ein paar andere Gedanken, die beschäftigen …
Die 60 Prozent und der informelle Druck
Die oft zitierte Leistung von 60 Prozent des letzten Nettoentgelts soll motivieren, nicht einrichten. Übergang ermöglichen, nicht ersetzen. In der Realität erzeugt sie einen Effekt, über den selten gesprochen wird.
Nicht jede und nicht jeder hat das Glück, unmittelbar von einigermaßen bezahlter Arbeit in besser bezahlte Arbeit zu wechseln. Wer mit 60 Prozent seine Fixkosten nicht decken kann, steht vor einer nüchternen Rechnung – nicht aus Gier, sondern aus Notwendigkeit.
Die Optionen sind begrenzt:
– Rücklagen aufbrauchen
– Schulden machen
– private Hilfe
– oder Einkommen ergänzen, wo es möglich ist
Letzteres geschieht häufig informell. Nicht, weil Menschen Regeln missachten wollen, sondern weil das System eine Lücke lässt, die sich legal nicht schließen lässt. Das ist kein moralisches Versagen, es ist schlichtweg auch nur ökonomische Logik – und zwar für Betroffene.
Aufstockung – die theoretische Lösung
Natürlich gibt es die Möglichkeit der Aufstockung. Wohngeld, ergänzende Leistungen, Zuschüsse. Das ist korrekt, aber auch unvollständig. Wer die Antragstellung auf Arbeitslosengeld einmal durchlebt hat, entwickelt eine sehr rationale Abneigung gegen weitere formale Prozesse.
Weitere Anträge bedeuten:
– neue Zuständigkeiten
– neue Formulare
– neue Nachweise
– neue Prüfungen
– neue Unsicherheiten
Vor allem aber bedeuten sie: erneute Offenlegung der gesamten Lebenssituation.
Nach Wochen der Wartezeit und der formalen Entwertung ist die Schwelle niedrig, an der man sagt: Das halte ich nicht noch einmal aus.
Aufstockung ist kein Ergänzen, sie ist eine Vertiefung des Zugriffs. Damit entsteht ein paradoxer Effekt: Das System bietet Hilfen an, gestaltet den Zugang aber so aufwendig, dass viele sie faktisch nicht in Anspruch nehmen.
Nicht unbedingt aus Stolz, sondern aus Erschöpfung.
Versicherung ohne Sicherheitsgefühl
Versicherung bedeutet intuitiv: Ich zahle ein, damit ich im Ernstfall nicht allein bin. Die Arbeitslosenversicherung funktioniert anders. Sie prüft, ob man die Voraussetzungen erfüllt, während man sich bereits im Ernstfall befindet.
Man ist nicht abgesichert, sondern auf Bewährung. Nicht moralisch. Formal.
45 Jahre Einzahlung erzeugen keinen Vertrauensbonus, keine Beschleunigung, keine andere Tonlage. Man ist kein langjähriger Versicherter, sondern ein Antrag unter vielen.
Das ist administrativ logisch.
Sozial ist es eiskalt.
Zerstörtes Vertrauen
Die Arbeitslosenversicherung hat funktioniert.
Formal.
Rechnerisch.
Rechtlich korrekt.
Und genau das ist das Problem, denn sie schützt nicht vor Unsicherheit, sondern verwaltet sie. Sie greift nicht präventiv, sondern rückwirkend. Sie zahlt, wenn alles vorbei ist, nicht wenn es kritisch wird.
Nach 45 Jahren Einzahlung bleibt kein Gefühl von Sicherheit zurück, sondern die Erkenntnis:
Versichert ist man. Abgesichert nur, wenn man Glück hat.
Und eine Gesellschaft, die Übergänge dem Glück überlässt, sollte sich nicht wundern, wenn Vertrauen leise verschwindet.
Misstrauenskultur
Problem ist nicht die Inkompetenz einzelner, sondern eine politisch-gesellschaftliche Grundhaltung. Nur auf den Staat zu schimpfen greift daher zu kurz. Diese Regeln sind nicht vom Himmel gefallen.
Wir haben sie selbst erschaffen.
Aus Angst vor Missbrauch. Aus der Vorstellung heraus, dass einige wenige etwas bekommen könnten, das ihnen angeblich nicht zusteht – obwohl genau diese wenigen es ohnehin immer schaffen, Schlupflöcher zu finden.
Diese Missgunst richtet sich nicht nach oben, sondern nach unten. Und genau das zieht sich wie ein roter Faden durch viele Bereiche unserer Gesellschaft.
Bis hin zu den banalsten Dingen: Man stellt lieber keine oder zu wenige Mülleimer im öffentlichen Raum auf, damit niemand „unberechtigt“ etwas hineinwirft – und wundert sich anschließend über den Dreck auf der Straße und über ständig überfüllte Behälter. Es gibt an dieser Stelle genügend Beispiele. Ob öffentliche Toiletten und Plätze, Mediatheken, Ämter oder Einrichtungen, man ist mit maximaler Kontrolle und Misstrauen konfrontiert.
Und natürlich sind es dann wieder genau jene, die man ohnehin im Visier hat, denen man die Schuld gibt. Lieber verzichtet man auf funktionierende, bürgernahe Infrastruktur, als das Risiko einzugehen, dass jemand etwas bekommen könnte, was man ihm nicht gönnt.
Es erinnert fatal an eine alte Analogie mit einer guten Fee:
Die Fee trifft im Wald die deutsche Misstrauenskultur. Sie darf sich etwas wünschen. Eine Bedingung: Normale Bürger:innen bekämen das Doppelte.
Die Kultur überlegt kurz und sagt:
„Dann stich mir ein Auge aus“.
Nochmal an dieser Stelle: Wir sind der Staat, wir selbst sind eigentlich verantwortlich für unsere kulturelle Missgunst – die uns dann in die Augen sticht.
Epilog
Ob ich es heute noch einmal so machen würde, kann ich nicht sicher beantworten. Selbst verzichtete ich auf Nervenschonung und auch auf Geld – den Unterschied zwischen Lohnfortzahlung, Krankengeld und Arbeitslosengeld I.
Ich würde aber allen raten, vor einer solchen Entscheidung ehrlich zu prüfen, wie belastbar die eigene Ehrlichkeit, das Nervenkostüm und die finanzielle Situation tatsächlich sind.
Ehrlichkeit, Integrität und Selbstachtung muss man sich leisten können.
Das klingt brutal, vielleicht sogar arrogant, ist aber vor allem eine unbequeme Realität: Wer unter existenziellem Druck steht, verhandelt Moral nicht im luftleeren Raum.
Wenn daher Ehrlichkeits- und Leistungsforderungen von Gutsituierten reflexhaft an Schwächere adressiert werden, ist das nicht nur blind für deren Situation. Es ist schlicht unverschämt, weil dabei eigene moralische Ansprüche konsequent nach unten delegiert werden.
Eines ist jedenfalls klar: Der Gang zum Arzt wäre sozial wärmer gewesen. Ungewissheit mit extra Wartezeit hätte keine zusätzliche Angst erzeugt.
Dass manche Menschen „einfachere“ Wege gehen, erscheint mir nach dieser Erfahrung nicht mehr als moralisches Versagen, sondern als nachvollziehbare Reaktion auf ein System, das Misstrauen organisiert und Ehrlichkeit prüft, statt sie zu tragen.
Ein anderer Gedanke drängt sich mir daher auf: Ich habe es im Text schon kurz erwähnt: In dieser Phase war die verlässlichste, erklärendste und sozial wärmste Begleitung nicht Teil des Systems, in das ich jahrzehntelang eingezahlt habe.
Es war m-eine KI.
Sie hat keine Entscheidungen für mich getroffen, sie hat erklärt, strukturiert, zugehört und nicht misstraut.
Dass ich das so schreibe, ist kein Lob auf Technologie. Es ist ein stilles Urteil über ein System, das seine Menschen so allein lässt, dass sie sich freiwillig an Maschinen wenden.
Mein Fazit
Es braucht einen Paradigmenwechsel. Das System muss nicht primär Missbrauch verhindern, sondern Sicherheit garantieren. Ehrliche Bürger:innen müssen der Maßstab für Systeme sein, nicht potenzielle Betrüger:innen. Kollektivstrafe für alle ist kein Erziehungsinstrument, sondern ein Vertrauensvernichter.
Aber das wäre zu einfach …
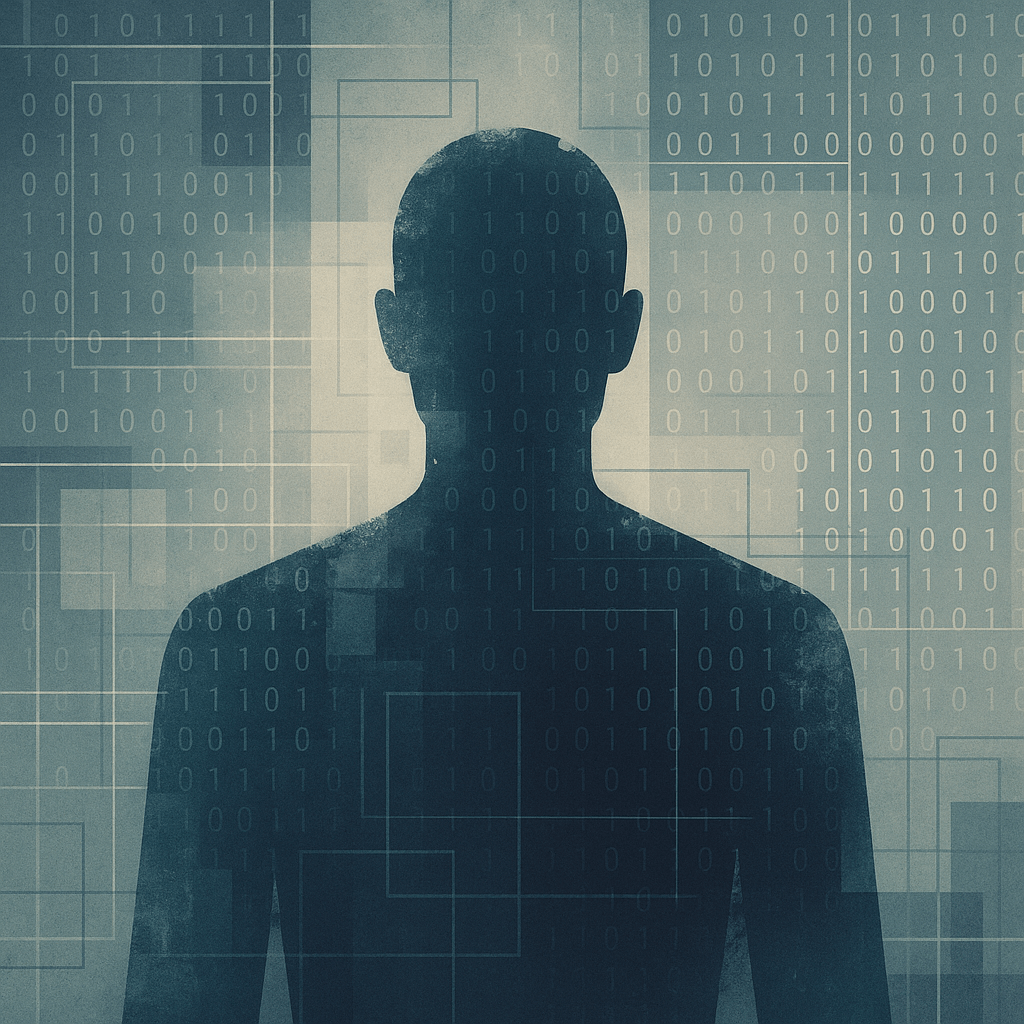
Hinterlasse einen Kommentar